Am Samstag, den 15. März, verwandelte sich der graue Berliner Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche in ein farbenfrohes Blütenmeer. 50.000 Tulpen in leuchtenden Farben schmückten den Platz und ließen den nahenden Frühling spüren.
Tulip Day, Tulpentag, nannte sich die Veranstaltung, organisiert von der niederländischen Botschaft und der „Tulpen Promotie Nederland“, der Vereinigung niederländischer Tulpenbetriebe. Auch in Amsterdam und anderenorts finden solche Tulip Days statt. Sie läuten die Tulpensaison und damit den Frühling ein.
Ich erfuhr davon im Radio und da ich gerade in Berlin war, wollte ich mir das Spektakel mal anschauen. Um 12 Uhr sollte es losgehen, dann nämlich würden die Tulpen verschenkt werden, hieß es im Radio. Jeder dürfe sich zehn Pflanzen aussuchen und gratis mitnehmen. Man rechnete mit einem großen Ansturm und riet daher zu frühem Erscheinen. Also machte ich mich rechtzeitig auf den Weg.
Als ich den Platz erreichte, war er bereits voller Menschen. Die Tulpen standen dicht an dicht, ein Meer aus Rot, Gelb, Violett und Rosa, umgeben von langen Warteschlangen. Die Stimmung war bestens. Leute aller Altersklassen plauderten, lachten, machten Fotos und warteten geduldig auf den Beginn.
Die Tulpe – ein Symbol der Niederlande
Windmühlen, die Farbe Orange, Käse, Fahrräder und Delfter Keramik – all das und manches mehr gehört zur niederländischen Kultur. Aber die Tulpe nimmt unter diesen Symbolen einen ganz besonderen Platz ein. Sie ist das florale Aushängeschild des Landes und zudem ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.
Holland ist der größte Tulpenlieferant der Welt
Rund achtzig Prozent der weltweit produzierten Tulpenzwiebeln stammen aus den Niederlanden.
Der berühmte Keukenhof südlich von Amsterdam zieht jedes Frühjahr Hunderttausende von Besuchern aus aller Welt an, die die farbenprächtigen Blütenfelder bestaunen.
Von den Steppen Zentralasiens nach Europa
Die Tulpe ist zwar Teil der niederländischen Kultur, doch stammt sie ursprünglich nicht von dort. Die Vorfahren der heute so beliebten Zierpflanze waren in den kargen Steppen- und Bergregionen Zentralasiens beheimatet, im heutigen Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan. Von dort begann ihre lange Reise entlang der Handelsrouten in Richtung Westen, wo sie über Jahrhunderte kultiviert wurde und zunehmend an Bedeutung gewann.
Die Perser nannten die Tulpe Lale und sahen in ihr ein Symbol der Vollkommenheit, Schönheit und göttlichen Liebe. Ihre Blütenform erinnerte an das arabisch geschriebene Wort für Allah. Seit dem 9. Jahrhundert erwähnten persische Dichter sie in ihren Versen – darunter der Lyriker Mohammad Shams al-Din Hafez (1327-1390) aus Schiras, der unter dem Dichternamen Hafis berühmt wurde. Die leuchtend roten Blüten betrachtete er als Zeichen leidenschaftlicher Liebe.
Seit dem 9. Jahrhundert erwähnten persische Dichter sie in ihren Versen – darunter der Lyriker Mohammad Shams al-Din Hafez (1327-1390) aus Schiras, der unter dem Dichternamen Hafis berühmt wurde. Die leuchtend roten Blüten betrachtete er als Zeichen leidenschaftlicher Liebe.

Von Persien aus fand die Tulpe ihren Weg ins Osmanische Reich, wo sie höchste Wertschätzung erfuhr. Die Osmanen übernahmen die persische Bezeichnung und nannten sie ebenfalls Lale. Sie waren fasziniert von ihrer Vielfalt an Formen und Farben und schmückten mit ihr Gärten und Paläste. Die Tulpe wurde zum Statussymbol, zum Zeichen für Macht und Reichtum. Als beliebtes Motiv schmückte sie osmanische Teppiche, Keramiken und Manuskripte und wurde sogar zur Wappenblume der Sultane. Die sogenannte Tulpenzeit – die Lale Devri von 1718 bis 1730 – war eine kulturelle Blütezeit, in der prachtvolle Feste zu Ehren der Tulpe gefeiert wurden.
Die Tulpe wurde Teil der osmanischen Identität und ist bis heute die Nationalblume der Türkei.
Ein Geschenk für Europa
Als erster Europäer beschrieb Ogier Ghiselin de Busbecq die Tulpe und prägte ihren Namen.

Ogier Ghiselin de Busbecq (1522-1592) stammte aus Flandern. Er war der Sohn eines Ritters aus angesehenem Geschlecht, hatte klassische Philologie und Rechtswissenschaften in Löwen, Paris, Venedig, Bologna und Padua studiert und sprach sieben Sprachen fließend. 1552 trat er wie sein Vater in den diplomatischen Dienst der Habsburger Monarchie ein. 1554 schickte ihn Kaiser Ferdinand I. als Botschafter nach Konstantinopel, um mit Sultan Süleyman I. einen Waffenstillstand auszuhandeln. Das Osmanische Reich expandierte in jener Zeit nach Westen, hatte Ungarn geschlagen und 25 Jahre zuvor Wien belagert. Die Vorherrschaft in Mittel- und Osteuropa stand auf dem Spiel.

Als Busbecq Konstantinopel erreichte, war der Sultan auf Reisen. Drei Wochen wartete er vergeblich auf dessen Rückkehr, schließlich reiste er ihm hinterher, bis ins etwa 700 Kilometer weiter östlich gelegene Amasya. Dort gelang das ersehnte Treffen mit dem Sultan und auch ein Waffenstillstand kam zustande, wenn auch nur für sechs Monate. Das schien dennoch ein Erfolg zu sein, denn kaum zurück in Wien wurde Busbecq erneut von Kaiser Ferdinand als Botschafter nach Konstantinopel geschickt. Diesmal für sechs Jahre. Busbecq hatte ein offenes Wesen und großes Interesse an fremden Sprachen und Kulturen. Dadurch erwarb er im Laufe der Zeit nicht nur das Vertrauen des Sultans, sondern auch fundierte Kenntnisse zum Osmanischen Reich. In vier langen Texten, den sogenannten „Türkischen Briefen“, schilderte er seine Beobachtungen zu Alltag, Lebensumständen, politischem System und vielem anderen im Osmanischen Reich. Darunter auch die Liebe der Osmanen zur Tulpe. Diese in Latein verfassten Berichte fügte Busbecq später zusammen und veröffentlicht sie. Sie sind auch auf Deutsch erschienen. Noch erwähnt werden soll, dass er eine weitere Waffenruhe aushandeln konnte, diesmal für acht Jahre, die jedoch nach dem Tod Kaiser Ferdinands vorzeitig endete.
Als Busbecq 1562 nach Wien zurückbeordert wurde, beschenkte ihn der Sultan zum Abschied mit mehreren wertvollen Tulpen- und Hyazinthenzwiebeln und einigen Fliederpflanzen.
Busbecq nannte die Pflanze Tulipa turcarum, nach dem türkischen Wort Tülbent für Turban. Die Blüte schien der klassischen türkischen Kopfbedeckung zu ähneln.
Nach seiner Rückkehr sorgte er dafür, dass die Tulpen in Westeuropa bekannt wurden. Dabei wurde er tatkräftig von seinem Freund Charles de l’Écluse unterstützt.

Charles de l’Écluse (1526-1609), auch bekannt unter seinem latinisierten Namen Carolus Clusius, war Arzt und Botaniker und stammte wie Busbecq aus Flandern. Er war ein vielseitig interessierter und gut vernetzter Gelehrter, der unter anderem zur Familie Fugger Kontakt unterhielt und einige Jahre als Hofbotaniker für Maximilian II. in Wien tätig gewesen war. Auch hatte er als Professor für Botanik an der Universität Leiden gewirkt und eine Reihe herausragender Werke zur Pflanzenkunde veröffentlicht, darunter auch zur Tulpenzucht.
Die Tulpenmanie (1636-1637) – ein Wirtschaftskrimi aus Holland
In den Niederlanden wurden die Tulpen zu einem Symbol für wirtschaftlichen Erfolg, was vor allem unter wohlhabenden Kaufleuten die berühmte Tulpenmanie auslöste: Tulpen wurden zum Spekulationsobjekt.
Seltene und exotische Tulpenarten erreichten astronomische Preise, die dem Wert eines Grachtenhauses in Amsterdam entsprechen konnten. Manch gerade ersteigerte Tulpenzwiebel wechselte schon kurz darauf für einen noch höheren Preis den Besitzer. Bis die Spekulationsblase platzte und der Markt zusammenbrach. Ein Ereignis, das als erste dokumentierte Spekulationsblase in die Geschichte einging.
Der Liebe der Holländer zur Tulpe tat dies jedoch keinen Abbruch.
Die Tulpe – Eine Blume für die Welt
Mit Beginn der gewerblichen Tulpenzucht normalisierten sich die Preise. Heute sind die Niederlande das Zentrum des weltweiten Tulpenhandels. Über 5000 verschiedene Tulpenarten werden hier gezüchtet.
Sie ist auch nicht länger den Reichen und Mächtigen vorbehalten, sondern Teil der Alltagskultur und dennoch eine Blume mit großer Symbolkraft: „Was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam“, hieß es in dem Schlagerklassiker aus dem Jahre 1956. Natürlich müssen es rote Tulpen sein, die Liebe und Leidenschaft symbolisieren.
Eine Handvoll Frühling zum Mitnehmen
Die Warteschlangen waren lang und es ging nur langsam voran, denn es wurde immer nur eine begrenzte Anzahl an Leuten in das abgeriegelte Areal hineingelassen, damit jeder sich in Ruhe die Pflanzen ansehen und aussuchen konnte.
Am Einlass lagen Papiertüten bereit zur Mitnahme der erlaubten zehn Tulpen. Manche nahmen nur zwei, drei Pflanzen mit, andere dagegen hätten wohl am liebsten zwanzig eingesteckt. Auch die Wahl der Farbe schien einigen schwer zu fallen.
Als ich schließlich an der Reihe war, griff ich nach Tulpen in leuchtendem Gelb und während ich meine Tüte füllte, zeigte mir ein alter Herr, der vor mir in der Schlange ausgeharrt hatte, stolz seine Auswahl: zehn rote Tulpen. „Für meine Frau“, sagte er lächelnd. „Rot ist die Farbe der Liebe!“ Ich wünschte ihm und seiner Frau noch beste Gesundheit und zog schließlich mit meinem Schatz frohgelaunt von dannen: zehn gelbe Tulpen, eine Handvoll Frühling.
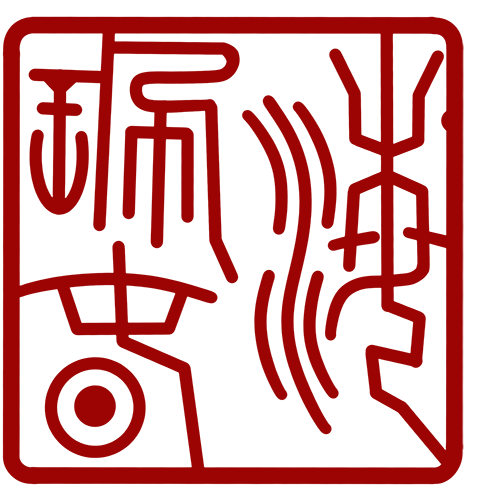
















2 Kommentare
Hallo Petra, durfte man die Tulpen mit Zwiebel mitnehmen? Oder musste man sie abschneiden?
Vielen Dank für den Bericht aus Berlin, super, was man alles erleben kann. Wenn man Interesse an Events hat, wird es nie langweilig. Es passiert so viel, und zusätzlich ist es noch kostenlos.
Liebe Grüße, Renate
Liebe Renate, tatsächlich durfte man die Tulpen mit Zwiebel mitnehmen. Herzliche Grüße, Petra